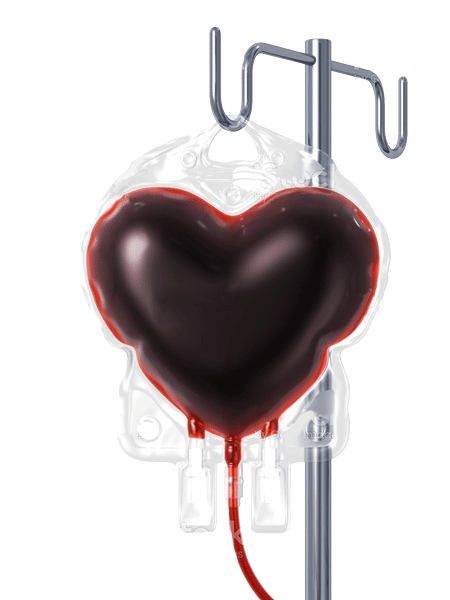DigiSep-Studie abgeschlossen: Ergebnisse an Gemeinsamen Bundesausschuss übergeben
Profitieren Patientinnen und Patienten mit Sepsis oder septischem Schock von digitaler Erregerdiagnostik zusätzlich zur Blutkultur? Und ist diese Diagnostik kostenneutral, weil die Behandlungsdauer kürzer und die Spätfolgen geringer werden? Diese und weitere Fragen hat die Studie „DigiSep – Optimierung der Sepsis-Therapie auf Basis einer patientenindividuellen digitalen Präzisionsdiagnostik“ seit 2021 untersucht. Nun konnte sie abgeschlossen und die vielversprechenden Ergebnisse zur weiteren Prüfung an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) übergeben werden. Der G-BA ist das höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen und entscheidet unter anderem, welche Diagnostikmethoden als Kassenleistung angeboten werden dürfen.
Drei Jahre Laufzeit, 410 zufällig ausgewählte Patientinnen und Patienten mit Sepsis oder septischem Schock, 24 beteiligte Kliniken, gefördert mit mehr als drei Millionen Euro – das sind die Eckdaten der DigiSep-Studie. Dahinter steht ein anspruchsvolles Projekt. „Personen mit Sepsis oder septischem Schock als Studienteilnehmende zu rekrutieren, ist nicht einfach. Und das war nur eine von vielen Herausforderungen dieser Studie. Ebenso war die klinische sowie gesundheitsökonomische Auswertung der Ergebnisse äußerst aufwändig“, berichtet Prof. Dr. Thorsten Brenner, Leiter des Forschungsprojekts und Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Universitätsklinikum Essen. „Deshalb sind wir sehr zufrieden, nun wertvolle Ergebnisse vorweisen zu können. Dies verdanken wir der engen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen namhaften deutschen Kliniken sowie hochkarätigen Konsortialpartnern, zu denen unter anderem auch führende deutsche Krankenkassen gehörten. Allen Beteiligten danke ich ganz herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit.“
Fristgerecht wurden vom DigiSep-Konsortium die Ergebnisse zum Monatsende Februar 2025 beim G-BA eingereicht. Die aufschlussreichen klinischen Erkenntnisse werden nun weiter geprüft. Auch die Ergebnisse der gesundheitsökonomischen Analyse, die sich auf die Daten der teilnehmenden Krankenkassen AOK Rheinland/Hamburg, BARMER sowie Techniker Krankenkasse stützt und rund ein Drittel der Fälle umfasst, wird in die abschließende Bewertung durch den G-BA einfließen. Eine Präsentation der Studienergebnisse wird im April 2025 im Rahmen des Congress of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) in Wien erfolgen, einem der weltgrößten medizinischen Fachkongresse für Infektionskrankheiten. Im direkten Anschluss sollen die Ergebnisse in einem hochrangigen medizinischen Fachjournal veröffentlicht werden, um die Daten möglichst allen an der Versorgung septischer Patientinnen und Patienten Beteiligten niederschwellig zugänglich zu machen. Darüber hinaus haben die beteiligten Krankenkassen bereits Interesse signalisiert, eine Fortführung des neuen Diagnostikverfahrens in der Versorgung zu prüfen, um ihren Versicherten auch weiterhin eine zukunftsweisende Erregerdiagnostik bei Sepsis oder septischem Schock zur Verfügung stellen zu können.
An der DigiSep-Studie waren neben der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Universitätsklinikum Essen als Konsortialführer 23 weitere deutsche Kliniken, der Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie & Gesundheitsmanagement der Universität Bielefeld, das Koordinierungszentrum für Klinische Studien (KKS) und das Institut für Medizinische Biometrie (IMBI) am Universitätsklinikum Heidelberg sowie die Krankenkassen AOK Rheinland/Hamburg, BARMER und Techniker Krankenkasse beteiligt. Das Diagnostikunternehmen Noscendo steuerte als technischer Partner seinen digitalen Präzisionstest DISQVER bei.
Über die DigiSep-Studie
Die Studie „DigiSep – Optimierung der Sepsis-Therapie auf Basis einer patientenindividuellen digitalen Präzisionsdiagnostik“ untersuchte, wie sich der Einsatz von digitaler Diagnostik auf die Sterblichkeit von Sepsis-Patientinnen und -Patienten, die Dauer ihrer Antibiotika-Therapie und ihre Verweildauer auf der Intensivstation auswirkt. Dazu wurde das Blut bei der Hälfte der Studienteilnehmenden (n=205) zusätzlich zu den Standardverfahren mit der Plattform DISQVER analysiert. Mit Hilfe von Next-Generation Sequencing (NGS) und Bioinformatik kann DISQVER innerhalb von 24 Stunden mehr als 16.000 Mikroben identifizieren, darunter 1.500 beschriebene Keime (Bakterien, DNA-Viren, Pilze und Parasiten). Innerhalb weniger Stunden herrscht so Klarheit über Art und Menge der Krankheitserreger im Blut, sodass passgenaue Antiinfektiva eingesetzt werden können. Bei der anderen Hälfte der teilnehmenden Patientinnen und Patienten (n=205) kam lediglich die derzeitige Standarddiagnostik zum Einsatz. Unterstützt wurden die behandelnden Intensivmedizinerinnen und -mediziner von einem beratenden Expertengremium.
Weitere Informationen unter https://www.digisep.de/.
Sepsis
Bei einer Sepsis, umgangssprachlich auch Blutvergiftung genannt, kann die körpereigene Abwehrreaktion auf eine Infektion, z. B. mit Bakterien oder Viren, so heftig ausfallen, dass Organe und Gewebe massiv geschädigt werden oder ganz versagen. Das macht die Erkrankung lebensbedrohlich. In Deutschland erkranken jährlich bis zu 300.000 Menschen an einer Sepsis; mindestens 85.000 sterben an oder mit Sepsis.
Weitere Informationen zu Sepsis:
https://www.sepsiswissen.de/
Innovationsfondsprojekt, das zur Aufklärung über Sepsis beitragen will
Sepsis Symposium – Zentrum für Intensivmedizin Metropole Ruhr (ZIMR)
Klinisches Symposium, das am Welt-Sepsis-Tag stattfindet
https://www.deutschland-erkennt-sepsis.de/
Kampagne des Aktionsbündnisses Patientensicherheit
Pressekontakt
Universitätsmedizin Essen
Burkhard Büscher
Konzernkommunikation
Tel.: 0201/723-2115
Mobil: 0151/117 31306
burkhard.buescher@uk-essen.de
www.uk-essen.de
Über die Essener Universitätsmedizin Die Essener Universitätsmedizin umfasst das Universitätsklinikum Essen sowie 15 Tochterunternehmen, darunter die Ruhrlandklinik, das St. Josef Krankenhaus Werden, die Herzchirurgie Huttrop und das Westdeutsche Protonentherapiezentrum Essen. Die Essener Universitätsmedizin ist mit etwa 1.700 Betten und rund 11.000 Mitarbeitenden das führende Gesundheits-Kompetenzzentrum des Ruhrgebiets. Mit dem Westdeutschen Tumorzentrum, einem der größten Tumorzentren Deutschlands, dem Westdeutschen Zentrum für Organtransplantation, einem international führenden Zentrum für Transplantation, in dem unsere Spezialisten mit Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, Herz und Lunge alle lebenswichtigen Organe verpflanzen, sowie dem Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrum, einem überregionalen Zentrum der kardiovaskulären Maximalversorgung, hat die Universitätsmedizin Essen eine weit über die Region reichende Bedeutung für die Versorgung von Patientinnen und Patienten. Wesentliche Grundlage für die klinische Leistungsfähigkeit ist die Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen mit ihrer Schwerpunktsetzung in Onkologie, Transplantation, Herz-Gefäß-Medizin, Immunologie/Infektiologie und Translationale Neuro- und Verhaltenswissenschaften.